Spinn- und Ansitzangeln in Deutschland und den Niederlanden
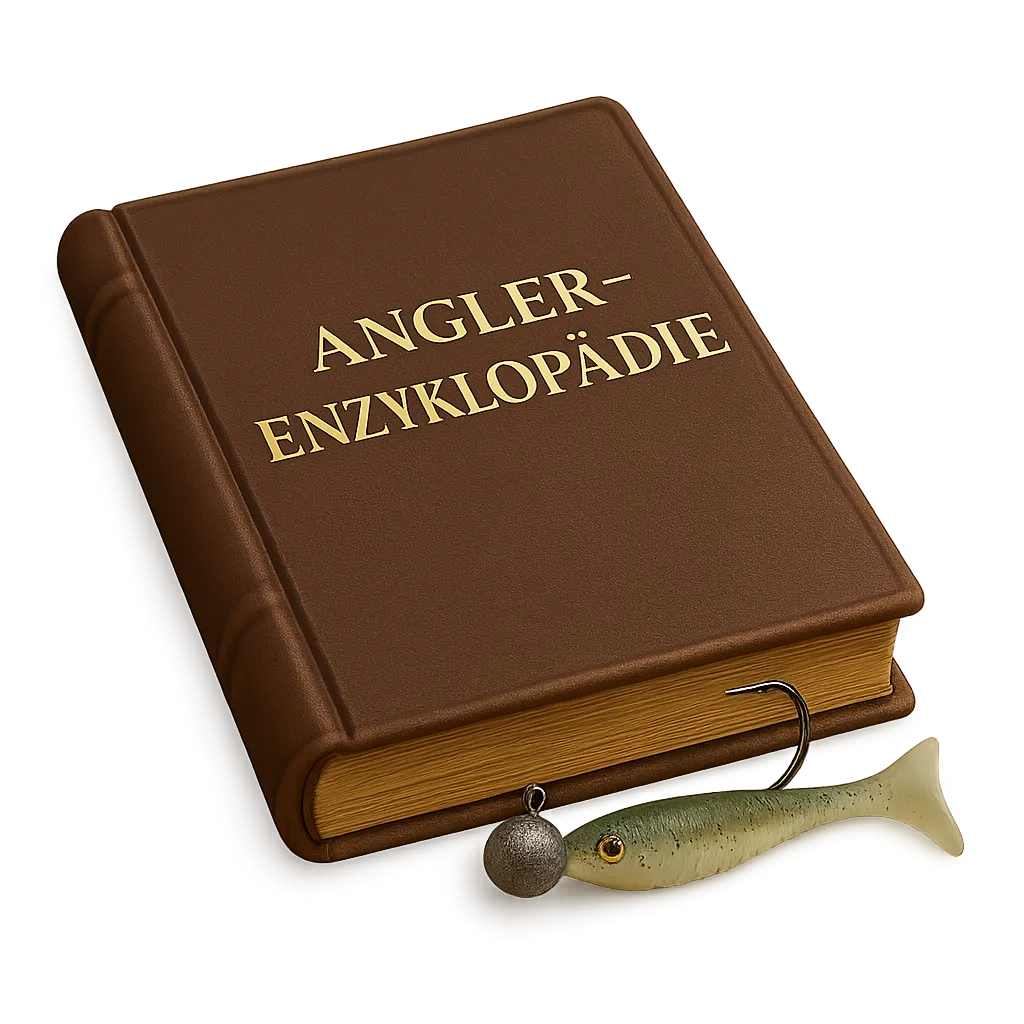
Willkommen in der Angler-Enzyklopädie von Lost in Nature. Hier findest du kompakte Vergleiche, bewährte Erfahrungen und praxisnahe Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ob beim Spinnfischen oder Ansitzangeln – wir zeigen dir klar und verständlich, worauf es ankommt. Schritt für Schritt, ohne Fachchinesisch – damit du schneller ans Wasser und zu deinem eigenen Erfolg kommst.
Inhaltsverzeichnis
Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland – Bundesländer
Deutschland hat keine einheitliche Regelung für Schonzeiten und Mindestmaße – sie werden von den einzelnen Bundesländern festgelegt. Hier findest du die wichtigsten Angaben für die häufigsten Zielfische, sortiert nach Bundesland. Diese Übersicht dient als Orientierung – vor dem Angeln immer die aktuellen Vorschriften prüfen.
Bayern
- Hecht: 15.02.–30.04. · 60 cm
- Zander: 15.02.–30.04. · 50 cm
- Bachforelle: 01.10.–28.02. · 26 cm
- Äsche: 01.01.–30.04. · 35 cm
- Aal: 01.10.–31.12. · 50 cm
- Wels: – · 70 cm
- Seeforelle: 01.10.–28.02. · 60 cm
- Schmerle: ganzjährig geschont
Nordrhein-Westfalen
- Hecht: 15.02.–30.04. · 45 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 45 cm
- Bachforelle: 20.10.–15.03. · 30 cm
- Aal: 01.10.-01.03. · 50 cm
- Wels: – · –
- Barbe: 01.05.–15.06. · 40 cm
- Steinbeißer: ganzjährig geschont
Brandenburg
- Hecht: 01.02.–30.04. · 60 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 50 cm
- Bachforelle: 01.10.–31.03. · 30 cm
- Aal: – · 50 cm
- Wels: – · 60 cm
- Rapfen: 01.04.–31.05. · 50 cm
- Schlammpeitzger: ganzjährig geschont
Niedersachsen
- Hecht: 15.02.–30.04. · 45 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 45 cm
- Bachforelle: 01.10.–28.02. · 25 cm
- Aal: – · 50 cm
- Wels: – · –
- Seeforelle: 01.10.–28.02. · 60 cm
- Elritze: ganzjährig geschont
Hessen
- Hecht: 15.02.–30.04. · 50 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 50 cm
- Bachforelle: 01.10.–28.02. · 30 cm
- Aal: 15.09.–01.03. · 50 cm
- Wels: – · –
- Barbe: 01.05.–30.06. · 40 cm
- Groppe: ganzjährig geschont
Sachsen
- Hecht: 01.02.–30.04. · 60 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 50 cm
- Bachforelle: 01.10.–31.03. · 28 cm
- Aal: – · 50 cm
- Wels: – · 60 cm
- Elritze: ganzjährig geschont
Sachsen-Anhalt
- Hecht: 01.02.–30.04. · 60 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 50 cm
- Bachforelle: 01.10.–31.03. · 30 cm
- Aal: – · 50 cm
- Wels: – · –
- Steinbeißer: ganzjährig geschont
Schleswig-Holstein
- Hecht: 01.02.–30.04. · 60 cm
- Zander: – · – (regional unterschiedlich)
- Bachforelle: 01.10.–28.02. · 26 cm
- Aal: – · 45 cm
- Wels: – · –
- Flunder: 15.02.–30.04. · 25 cm
- Meerneunauge: ganzjährig geschont
Berlin
- Hecht: 01.02.–30.04. · 55 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 45 cm
- Bachforelle: 01.10.–31.03. · 30 cm
- Aal: – · 50 cm
- Wels: – · 60 cm
- Moderlieschen: ganzjährig geschont
Thüringen
- Hecht: 01.02.–30.04. · 55 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 50 cm
- Bachforelle: 01.10.–31.03. · 30 cm
- Aal: – · 50 cm
- Wels: – · 60 cm
- Schlammpeitzger: ganzjährig geschont
Baden-Württemberg
- Hecht: 15.02.–30.04. · 60 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 50 cm
- Bachforelle: 01.10.–28.02. · 30 cm
- Aal: 15.09.–01.03. · 50 cm
- Wels: – · –
- Groppe: ganzjährig geschont
Bremen
- Hecht: 15.02.–30.04. · 45 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 45 cm
- Bachforelle: 01.10.–28.02. · 25 cm
- Aal: – · 50 cm
- Wels: – · –
- Stichling: ganzjährig geschont
Hamburg
- Hecht: 01.02.–15.04. · 45 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 45 cm
- Bachforelle: 15.10.–15.02. · 30 cm
- Aal: – · 50 cm
- Wels: – · –
- Finte: ganzjährig geschont
Rheinland-Pfalz
- Hecht: 15.02.–30.04. · 60 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 50 cm
- Bachforelle: 01.10.–28.02. · 30 cm
- Aal: 15.09.–01.03. · 50 cm
- Wels: – · –
- Moderlieschen: ganzjährig geschont
Saarland
- Hecht: 15.02.–30.04. · 60 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 50 cm
- Bachforelle: 01.10.–28.02. · 30 cm
- Aal: 15.09.–01.03. · 50 cm
- Wels: – · –
- Stromgründling: ganzjährig geschont
Mecklenburg-Vorpommern
- Hecht: 01.02.–31.03. · 60 cm
- Zander: 01.04.–31.05. · 45 cm
- Bachforelle: 01.10.–28.02. · 30 cm
- Aal: 15.09.–01.03. · 50 cm
- Wels: – · –
- Flunder: 15.02.–30.04. · 25 cm
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Regionale Ausnahmen, private Pachtgewässer oder Sonderregelungen sind möglich.
Quelle (für aktuelle Details): schonzeiten.de
Monofile oder geflochtene Schnur?
Die Wahl der Angelschnur beeinflusst unmittelbar die Erfolgschancen beim Ansitz- und Spinnfischen. Monofile und geflochtene Schnüre bieten jeweils spezifische Vorteile, die je nach Fischart, Gewässertyp und Angeltechnik bewusst eingesetzt werden sollten.
Monofile Schnur
Monofile Schnüre bestehen aus einem durchgehenden Nylonstrang. Sie überzeugen durch ihre Dehnbarkeit und unauffällige Präsentation unter Wasser.
Vorteile von Monofiler Schnur:
- ✔️ Dehnungsfähigkeit schluckt Fluchten und Kopfschläge zuverlässig.
- ✔️ Unauffälligkeit unter Wasser – besonders bei scheuen Fischen von Vorteil.
- ✔️ Günstiger Preis und hohe Verfügbarkeit.
Nachteile von Monofiler Schnur:
- ⚠️ Geringere Tragkraft im Vergleich zu geflochtener Schnur bei gleichem Durchmesser.
- ⚠️ Dehnung mindert die direkte Bisserkennung, besonders auf Distanz.
- ⚠️ Anfällig für UV-Schäden und Alterung.
Geflochtene Schnur
Geflochtene Schnüre bestehen aus mehreren verflochtenen Kunstfasern, wie zum Beispiel Polyamid, Polypropylen oder Polyester. und bieten maximale Tragkraft bei minimalem Durchmesser und kaum Dehnung.
Vorteile von Geflochtener Schnur:
- ✔️ Extrem hohe Tragkraft bei gleichzeitig geringem Durchmesser.
- ✔️ Kaum Dehnung, dadurch perfekte Bisserkennung auch auf weite Distanz.
- ✔️ Dünner und flexibler als Monofile – erleichtert präzises Knotenbinden.
Nachteile von Geflochtener Schnur:
- ⚠️ Häufig Einsatz eines Stahl oder Fluorocarbon-Vorfachs notwendig.
- ⚠️ Erhöhte Anfälligkeit für Abrieb an Hindernissen.
- ⚠️ Meist teurer als monofile Angelschnur, besonders wenn Made in Japan draufsteht.
Kombination beider Systeme
Viele moderne Angler kombinieren eine geflochtene Hauptschnur mit einem monofilen oder fluorocarbon Vorfach. Diese Kombination verbindet die Vorteile: hohe Sensibilität und Tragkraft der Geflochtenen, mit der Unauffälligkeit und Abriebfestigkeit einer monofilen Angelschnur.
Wann welche Schnur?
Monofile Schnüre werden traditionell beim Ansitzangeln auf Fried- und Weißfische eingesetzt, wo Dehnbarkeit und Unauffälligkeit gefragt sind. Auch beim Raubfischansitz – etwa auf Hecht – wird Mono genutzt, jedoch fast immer in Kombination mit einem Stahlvorfach zum Schutz vor Fehlbissen/Abreißer.
Geflochtene Schnüre dominieren beim aktiven Spinnfischen auf Barsch, Zander und Hecht, da hier geringe Dehnung, hohe Sensibilität und weite Würfe mit Kunstködern entscheidend sind. Besonders beim Fischen mit leichten Hard- oder Softbaits entfaltet die geflochtene ihre Stärken.
Eine wichtige Ausnahme bildet das Welsangeln: Beim stationären Ansitz auf Welse oder beim aktiven Klopfen wird bevorzugt dicke geflochtene Schnur eingesetzt. Durch die enorme Tragkraft bei gleichzeitig schlankem Durchmesser kann ausreichend Schnur auf der Rolle untergebracht werden. Trotzdem kommt in diesen Fällen zusätzlich eine abriebfeste Schlagschnur oder ein kräftiges Fluorocarbon-Vorfach zum Einsatz, um Abrieb an Hindernissen zu vermeiden.
Zusammengefasst:
Monofile Schnüre eignen sich hervorragend für unauffällige Präsentationen bei Fried- und Raubfischen im Ansitzangeln. Geflochtene Schnüre überzeugen beim Spinnfischen durch Sensibilität, Tragkraft und Wurfweite, sowie bei Spezialtechniken wie dem Welsangeln. Der gezielte Einsatz oder die Kombination beider Systeme maximiert die Erfolgsquote je nach Situation.
Stationärrolle oder Baitcast?
Die Wahl zwischen Stationärrolle und Baitcaster beeinflusst die Köderführung, Wurfweite und den Angelkomfort. Beide Rollentypen haben spezifische Stärken und Schwächen, die je nach Angeltechnik, Ködergewicht und persönlicher Vorliebe gezielt eingesetzt werden können.
Stationärrolle
Stationärrollen gehören zur klassischen Standardausrüstung vieler Angler. Sie bieten einfaches Handling und sind sehr vielseitig einsetzbar.
Vorteile der Stationärrolle:
- ✔️ Einfaches Werfen – ideal für Einsteiger und Allroundangler.
- ✔️ Gute Leistung beim Werfen leichter bis mittelschwerer Köder.
- ✔️ Geringer Pflegeaufwand und hohe Fehlertoleranz.
- ✔️ Vielseitig nutzbar vom Spinnfischen bis zum leichten Ansitzangeln.
Nachteile der Stationärrolle:
- ⚠️ Leichter Schnurdrall bei häufigem Werfen, besonders mit dünnen Schnüren.
- ⚠️ Bei schweren Montagen etwas weniger direkte Kraftübertragung im Vergleich zur Baitcaster.
Baitcaster
Baitcaster-Rollen sind besonders bei erfahrenen Spinnanglern beliebt. Sie ermöglichen gezieltes Werfen und bieten Vorteile bei der Köderkontrolle, insbesondere bei schwereren Ködern.
Vorteile der Baitcaster:
- ✔️ Präzisere Kontrolle über die Würfe bei entsprechender Übung.
- ✔️ Stärkere Kraftübertragung – ideal für schwere Köder und starke Fische.
- ✔️ Direkterer Kontakt zur Schnur – feines Nachführen und kontrolliertes Präsentieren des Köders.
- ✔️ Geringerer Schnurdrall durch gleichmäßige Wicklung auf der Spule.
Nachteile der Baitcaster:
- ⚠️ Höhere Lernkurve – Gefahr von Backlashes bei unsauberem Werfen.
- ⚠️ Begrenzter Einsatzbereich bei sehr leichten Ködern (Sondermodelle erforderlich).
- ⚠️ Etwas aufwendigere Pflege und Feinabstimmung der Bremssysteme nötig.
Wann welche Rolle?
Stationärrollen sind die richtige Wahl für Angler, die unkompliziert verschiedene Techniken abdecken möchten oder bevorzugt mit leichten bis mittleren Ködern arbeiten. Ihre einfache Handhabung macht sie besonders einsteigerfreundlich.
Baitcaster bieten Vorteile bei schwereren Ködern, gezieltem Anwerfen bestimmter Spots und kraftvoller Köderführung. Sie verlangen jedoch Übung im Umgang mit der Bremse und der Wurftechnik.
Zusammengefasst:
Stationärrollen bieten Einfachheit, Vielseitigkeit und hohe Fehlertoleranz – ideal für Allroundeinsätze. Baitcaster ermöglichen eine kontrolliertere Köderführung und kraftvolles Handling schwerer Montagen, setzen aber eine gewisse Wurftechnik und Erfahrung voraus. Die Wahl hängt stark vom Einsatzzweck und dem persönlichen Stil ab.
Hard oder Softbait?
Beim Spinnfischen stehen Angler oft vor der Wahl zwischen Hardbaits und Softbaits. Beide Köderarten haben spezifische Stärken und Schwächen. Die richtige Wahl hängt stark von Zielfisch, Gewässertiefe, Pflanzenbewuchs, Wassertrübung und Witterungsbedingungen ab.
Hardbaits
Hardbaits sind harte Köder aus Kunststoff oder Holz, die durch stabile Konstruktion, starke Druckwellen und visuelle Reize überzeugen. Je nach Bauweise unterscheiden sie sich im Laufverhalten:
- ➤ Auftriebende Modelle: Ideal für die Oberflächenangelei und flache Zonen.
- ➤ Suspendierende Modelle: Bleiben beim Stopp in einer konstanten Tiefe stehen.
- ➤ Sinkende Modelle: Perfekt, um tiefer stehende Fische zu erreichen.
Vorteile von Hardbaits:
- ✔️ Präzise Kontrolle über Laufverhalten und Tauchtiefe.
- ✔️ Zusätzliche akustische Reize durch Rasseln oder Klapperkammern.
- ✔️ Extrem robust und langlebig gegenüber Hindernissen und Bissen.
- ✔️ Hohe Lockwirkung auf aggressive Räuber.
Nachteile von Hardbaits:
- ⚠️ Hohes Risiko von Hängern in Kraut oder Steinen.
- ⚠️ Relativ hohe Anschaffungskosten pro Köder.
- ⚠️ Weniger effektiv bei sehr passiven oder vorsichtigen Fischen.
Softbaits
Softbaits sind flexible Köder aus weichem Kunststoff und bestechen durch natürliche Bewegungen und vielseitige Montagemöglichkeiten. Ihr Sinkverhalten variiert je nach Jiggewicht und Ködergröße:
- ➤ Leichte Jigs: Langsames Absinken, ideal für flache oder strukturreiche Bereiche.
- ➤ Schwere Jigs: Schnelles Absinken, geeignet für tiefe Seen und Flüsse.
Vorteile von Softbaits:
- ✔️ Realistisches, flexibles Spiel im Wasser.
- ✔️ Anpassbar an nahezu jede Angelsituation.
- ✔️ Krautfreie Präsentation möglich durch Offset-Haken.
- ✔️ Günstige Anschaffung und große Köderauswahl.
Nachteile von Softbaits:
- ⚠️ Material verschleißt schneller bei Bissen und Hindernissen.
- ⚠️ Offset-Montagen erfordern kräftigen und präzisen Anhieb.
- ⚠️ Anfällig gegenüber extremen Temperaturen (Härten oder Weichwerden).
Wann welcher Köder?
Hardbaits sind besonders effektiv, wenn Raubfische aktiv jagen oder durch laute, auffällige Reize zum Biss provoziert werden sollen. Sie ermöglichen eine präzise Tiefenkontrolle und hohe Reichweite.
Softbaits glänzen, wenn die Fische vorsichtig oder inaktiv sind, besonders in dicht bewachsenen Gewässern oder bei wechselnden Bedingungen. Durch verschiedene Montagen können Softbaits nahezu jeder Situation angepasst werden.
Zusammengefasst:
Erfolgreiche Spinnangler setzen flexibel beide Köderarten ein und passen ihre Strategie je nach Tageszeit, Jahreszeit und Fischverhalten an. Vielseitigkeit und Beobachtungsgabe sind entscheidend für konstanten Erfolg am Wasser.
Teleskoprute oder Steckrute?
Die Wahl zwischen Teleskoprute und Steckrute spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf Mobilität, Robustheit und Feinfühligkeit beim Angeln. Beide Rutentypen haben klare Vorteile und Nachteile, die je nach Einsatzzweck und persönlichen Vorlieben gezielt genutzt werden können.
Teleskoprute
Teleskopruten sind so konstruiert, dass sie zusammengeschoben werden können. Dadurch sind sie besonders kompakt und schnell einsatzbereit. Hochwertige Modelle weisen ähnliche Angeleigenschaften wie Steckruten auf
Vorteile der Teleskoprute:
- ✔️ Sehr kompakt – ideal für den Transport und mobile Angeltouren.
- ✔️ Schnell auf- und abzubauen.
- ✔️ Platzsparend im Auto, Rucksack oder auf Reisen.
- ✔️ Praktisch bei spontanen oder kurzen Angelausflügen.
Nachteile der Teleskoprute:
- ⚠️ Geringere Sensibilität im Vergleich zu hochwertigen Steckruten.
- ⚠️ Erhöhte Bruchgefahr an den Verbindungen bei hoher Belastung.
- ⚠️ Schmutz oder Sand im Teleskopsystem kann die Funktion beeinträchtigen.
Steckrute
Steckruten bestehen aus zwei oder mehreren Einzelteilen, die zusammengesteckt werden. Sie bieten in der Regel eine bessere Aktion und höhere Stabilität.
Vorteile der Steckrute:
- ✔️ Höhere Sensibilität und direkteres Ködergefühl.
- ✔️ Bessere Kraftübertragung und Stabilität – auch bei größeren Fischen.
- ✔️ Meist langlebiger bei sachgemäßer Handhabung.
- ✔️ Sehr präzise Wurfeigenschaften, ideal für zielgerichtetes Angeln.
Nachteile der Steckrute:
- ⚠️ Größeres Transportmaß – sperriger als Teleskopruten.
- ⚠️ Aufbau dauert etwas länger im Vergleich zur Teleskoprute.
- ⚠️ Gefahr des Verkantens oder Verklebens der Steckverbindungen bei unsachgemäßer Pflege.
Wann welche Rute?
Teleskopruten sind ideal für mobile Angler, die kompakte Ausrüstung bevorzugen und Wert auf schnelle Einsatzbereitschaft legen. Sie eignen sich gut für spontane Ausflüge, Urlaube oder das Angeln an schwer zugänglichen Gewässern.
Steckruten hingegen bieten bei gezieltem Ansitz- oder Spinnfischen klare Vorteile in Sachen Sensibilität, Kraftübertragung und Langlebigkeit. Besonders bei anspruchsvollen Techniken oder beim gezielten Angeln auf größere Fische sind Steckruten die erste Wahl.
Zusammengefasst:
Teleskopruten bieten maximale Mobilität und schnellen Einsatz – ideal für unterwegs oder kurze Sessions. Steckruten überzeugen durch überlegene Aktion, Stabilität und feineres Ködergefühl, insbesondere bei anspruchsvolleren Angelmethoden. Die Entscheidung hängt vom gewünschten Komfort, Transportbedarf und der anglerischen Zielsetzung ab.
Welche Rollengröße für welches Angeln?
Die Wahl der richtigen Rollengröße beeinflusst das Handling der Rute, die Wurfweite, das Verhalten im Drill und die Flexibilität beim Angeln. Besonders bei Stationärrollen gibt es klare Unterschiede je nach Zielfisch, Schnurstärke und Angeltechnik.
Kleine Rollen (1000 bis 1500)
Sehr kompakte Rollen, die vor allem für feine Angelei genutzt werden. Typische Einsatzgebiete:
- ✔️ Ultraleichtes Spinnfischen auf Forellen, Döbel oder Barsche.
- ✔️ Spoon-Angeln am Forellenteich.
- ✔️ Kleine Posenruten für leichte Montagen.
Beispiel: 0,16 mm Monofile – etwa 100–130 Meter auf einer 1500er Rolle.
Mittlere Rollen (2000 bis 2500)
Die Allroundgröße für viele Spinnangler. Geeignet für kleinere bis mittlere Raubfische:
- ✔️ Barsch, Forelle, Zander – leicht bis mittelschweres Spinnfischen.
- ✔️ Leichte Posenruten oder Grundruten.
- ✔️ Genug Schnurfassung auch für Hechte – bei entsprechender Hauptschnurstärke.
Wichtig: Die Spule sollte stets bis knapp unter die Kante mit Schnur befüllt werden (nicht ganz bündig), um optimale Wurfweiten zu erreichen.
Beispiel: 0,10 mm Geflochtene – etwa 120–150 Meter auf einer 2500er Rolle.
Größere Rollen (3000 bis 3500)
Diese Größen werden oft für das Ansitzangeln oder mittlere bis schwerere Spinnfischen genutzt:
- ✔️ Weißfischangeln mit Posen- oder Grundmontagen.
- ✔️ Angeln auf größere Karpfenartige Fische, größere Friedfische oder Aale.
- ✔️ Spinnfischen auf Hechte und Zander mit größeren Kunstködern.
Beispiel: 0,30 mm Monofile – etwa 120–140 Meter auf einer 3000er Rolle.
Große Rollen (4000 bis 5000)
Für gezielte Ansitze auf größere Fische oder das schwere Spinnfischen:
- ✔️ Karpfenangeln mit schweren Montagen und langen Distanzen.
- ✔️ Hechtangeln mit großen Swimbaits oder Jerkbaits.
- ✔️ Grundangeln auf Wels oder schwere Feeder-Montagen.
Vorteil: Durch die größere Spule passen dickere Schnüre in ausreichender Menge auf die Rolle. Besonders beim Drill großer Fische sorgt das für Sicherheit und Reserven.
Beispiel: 0,35 mm Monofile – etwa 110–130 Meter auf einer 4000er Rolle.
Zusammengefasst:
Kleinere Rollen (1500–2500) eignen sich perfekt für feines Spinn- und Forellenangeln. Rollen zwischen 3000–3500 bieten ein breites Einsatzspektrum vom Ansitz auf Weißfische bis zum schweren Spinnfischen. Große Modelle (4000–5000) werden hauptsächlich eingesetzt, wenn große Schnurreserven und hohe Belastbarkeit gefragt sind.
Hinweis: Die Flexibilität von Stationärrollen ermöglicht es, sie je nach verwendeter Schnurart (z.B. Monofil oder geflochten) und Montageart flexibel an unterschiedliche Zielfische und Angeltechniken anzupassen. Mit der richtigen Schnur- und Rollenkombination kann ein Modell vielseitig eingesetzt werden.
Welche Hakenformen gibt es?
Beim Angeln ist der Haken das letzte und oft entscheidende Glied in der Kette. Doch Haken ist nicht gleich Haken: Es gibt verschiedenste Formen – und jede bringt ihre eigenen Stärken und Schwächen mit.
Rundbogenhaken (Round Bend Hook)
Einsatz: Klassischer Allrounder – gut geeignet für Naturköder wie Würmer, Maden, Mais. Beliebt beim Friedfischangeln auf Brassen, Rotauge oder kleinere Karpfen.
Vorteile:
- ✔️ Universell einsetzbar
- ✔️ Gute Bissverwertung
- ✔️ Einfach zu handhaben
Nachteile:
- ⚠️ Kein Spezialist – für bestimmte Situationen (z. B. krautige Gewässer) weniger optimal
- ⚠️ Bei voluminösen Ködern kann der Haken schlechter greifen
Weitbogenhaken (Wide Gap Hook)
Einsatz: Mehr Platz zwischen Spitze und Schenkel – ideal für große oder voluminöse Köder (z. B. Boilies, Wurmbündel, Gummiköder). Beliebt beim Raubfisch- und Karpfenangeln.
Vorteile:
- ✔️ Bessere Hakeigenschaften bei großen Ködern
- ✔️ Viel „Fangfläche“ für sichere Bisse
Nachteile:
- ⚠️ Größerer Haken = auffälliger für vorsichtige Fische
- ⚠️ Bei kleinen Fischarten oft überdimensioniert
Offset-Haken
Einsatz: Die Hakenspitze ist leicht versetzt – liegt eng am Köder an. Besonders geeignet für krautfreie Montagen (z. B. Texas oder Carolina Rig).
Vorteile:
- ✔️ Köder gleitet krautfrei durchs Wasser
- ✔️ Ideal für Gewässer mit vielen Hindernissen
Nachteile:
- ⚠️ Hakeffekt kann geringer sein – Fisch hakt sich nicht immer zuverlässig
- ⚠️ Für Anfänger anfangs gewöhnungsbedürftig
Kreishaken (Circle Hook)
Einsatz: Hakenspitze zeigt stark nach innen – sorgt für Selbsthakeffekt. Oft beim Brandungsangeln, Meeresangeln und beim Catch & Release.
Vorteile:
- ✔️ Kaum Schluckverletzungen – fischschonend
- ✔️ Selbsthakeffekt ohne kräftigen Anhieb
Nachteile:
- ⚠️ Funktioniert nicht gut beim aktiven Angeln (z. B. Spinnfischen)
- ⚠️ Erfordert Geduld: Kein klassischer Anschlag, sonst verliert man den Fisch
Drillinge (Treble Hook)
Einsatz: Drei Spitzen – klassisch bei Kunstködern wie Wobblern, Blinkern oder beim Raubfischangeln mit Köderfisch.
Vorteile:
- ✔️ Hohe Bissausbeute, da mehrere Spitzen greifen können
- ✔️ Ideal bei schnellen Attacken (z. B. Hecht)
Nachteile:
- ⚠️ Verletzungsgefahr für den Fisch deutlich höher
- ⚠️ Erhöht die Gefahr, sich selbst zu haken
- ⚠️ Teilweise in Catch & Release-Situationen nicht erlaubt oder unerwünscht
Einzelhaken mit langem Schenkel
Einsatz: Ideal für weiche Köder wie Würmer oder Forellenteig – leicht zu beködern und zu lösen.
Vorteile:
- ✔️ Einfaches Hakenlösen – gut für Anfänger
- ✔️ Köder verrutscht seltener
- ✔️ Gut geeignet zum Zurücksetzen
Nachteile:
- ⚠️ Lange Schenkel sind auffälliger
- ⚠️ Geringere Stabilität bei sehr großen Fischen
- ⚠️ Nicht ideal für kräftige Fluchten
Zusammengefasst:
Es gibt nicht den perfekten Haken – nur den richtigen für die jeweilige Situation. Wenn du weißt, was du wann fischen willst, und die Hakenform darauf abstimmst, holst du das Maximum aus jedem Ansitz raus. Wer beide Seiten kennt – Stärken und Schwächen –, trifft die besseren Entscheidungen am Wasser.
Fluorocarbon oder Stahlvorfach?
Beim Raubfischangeln entscheidet oft das richtige Vorfach über Erfolg oder Fehlbiss. Fluorocarbon und Stahl zählen zu den beliebtesten Materialien – beide mit eigenen Vorteilen, Einsatzbereichen und Einschränkungen. Wer weiß, wann welches Vorfach Sinn ergibt, angelt effizienter und fängt mehr.
Fluorocarbon – das unsichtbare Vorfach
Fluorocarbon ist ein Polymer (Polyvinylidenfluorid) mit nahezu identischem Lichtbrechungsindex wie Wasser – dadurch unter Wasser fast unsichtbar. Es ist abriebfest, sinkt schnell und wird vor allem beim Spinn- und Ansitzangeln auf vorsichtige Räuber eingesetzt.
Vorteile von Fluorocarbon:
- ✔️ Nahezu unsichtbar – ideal für klares Wasser und scheue Fische.
- ✔️ Hohe Abriebfestigkeit – schützt bei Hindernissen und Muschelbänken.
- ✔️ Sinkt schnell – direkte Köderpräsentation in Grundnähe.
- ✔️ UV-beständig – langlebiger als Monofil.
- ✔️ Geringe Dehnung – bessere Bisserkennung.
Nachteile von Fluorocarbon:
- ⚠️ Kein 100 % Bissschutz bei Raubfischen mit scharfen Zähnen (z. B. Hecht).
- ⚠️ Höherer Preis – besonders bei starken Durchmessern.
- ⚠️ Steifer als Monofile – kann bei leichten Ködern das Spiel beeinträchtigen.
- ⚠️ Knoten müssen sorgfältig gebunden werden – rutschgefahr!
Stahlvorfach – der Klassiker beim Hechtangeln
Stahlvorfächer bestehen aus feinen Edelstahldrähten, meist in 1x7, 7x7 oder beschichteter Ausführung. Sie bieten absolute Sicherheit bei Fischen mit harten oder scharfen Zähnen. Besonders beim Hechtangeln ist Stahl das Maß der Dinge – Fluorocarbon reicht hier nicht aus.
Vorteile von Stahlvorfach:
- ✔️ 100 % durchbisssicher – optimal für Hechte, Welse oder Zander mit harten Kiefern.
- ✔️ Flexibel – moderne 7x7-Vorfächer bieten gute Köderbewegung.
- ✔️ Wiederverwendbar – lange Lebensdauer bei richtiger Pflege.
- ✔️ Auch bei größeren Kunstködern problemlos einsetzbar.
Nachteile von Stahlvorfach:
- ⚠️ Sichtbar im Wasser – kann bei vorsichtigen Fischen die Bissrate senken.
- ⚠️ Weniger flexibel als Fluorocarbon – kann feines Köderspiel beeinträchtigen.
- ⚠️ Knickempfindlich – nach starkem Drill oder Hänger oft unbrauchbar.
Wann welches Vorfach?
Fluorocarbon ist die richtige Wahl bei klarem Wasser, hohem Angeldruck oder wenn Zander, Barsch, Döbel oder Forelle im Fokus stehen. Auch bei Karpfenmontagen oder zum Jiggen in hindernisreichen Zonen ist es effektiv.
Stahl ist unverzichtbar, wenn Hechte im Gewässer sind – besonders beim Spinnfischen mit Wobblern, Gummiködern oder beim Schleppen. Selbst beim Ansitz auf Zander kann ein dünnes 7x7-Stahlvorfach sinnvoll sein, wenn mit Hechtbissen gerechnet werden muss.
Alternativen & Kombis
Für sehr scheue Fische kann ein beschichtetes, dunkel gefärbtes 7x7-Stahlvorfach die Sichtbarkeit minimieren. Wer’s ultrafein will, setzt auf Titanvorfächer – flexibel, langlebig, aber teuer. Auch Kombis mit Fluorocarbon-Stück und Stahl-Segment sind möglich – z. B. bei Spinnmontagen mit Vorlauf.
Zusammengefasst:
Fluorocarbon ist unsichtbar, abriebfest und ideal für scheue oder kampfstarke Fische. Stahl bietet absolute Sicherheit bei Raubfischen mit Zähnen – und bleibt beim Hecht Pflicht. Die Wahl des Vorfachs sollte sich immer nach Zielfisch, Gewässer und Köder richten. Wer beide Materialien versteht und gezielt einsetzt, fängt konstanter und verliert weniger Fische.
Posenangeln oder Grundmontage?
Posenangeln und Grundangeln zählen zu den beliebtesten Methoden im Süßwasser – besonders bei Einsteigern. Doch welche Technik passt besser zu deinem Gewässer, Zielfisch und Setup? Beide haben ihre Stärken – und ganz eigene Reize.
Posenangeln
Die Pose – für viele das Sinnbild des Angelns. Beim Posenangeln wird der Köder in einer bestimmten Wassertiefe schwebend angeboten. Die Pose zeigt jeden noch so feinen Biss sichtbar an.
Vorteile beim Posenangeln:
- ✔️ Extrem präzise Bisserkennung – ideal für scheue oder vorsichtige Fische.
- ✔️ Visuell spannend – man „sieht“ den Biss, statt ihn nur zu spüren.
- ✔️ Perfekt für Flachwasser, Kanäle, Teiche und langsam fließende Gewässer.
- ✔️ Ideal für Weißfische wie Rotaugen, Brassen oder Schleien.
Nachteile beim Posenangeln:
- ⚠️ Wind und Wellen können die Pose unruhig machen – erschwert das Angeln.
- ⚠️ Weniger effektiv in tieferen oder strömungsstarken Gewässern.
- ⚠️ Erfordert exakte Ausbleiung und passende Posenform für stabile Führung.
Grundangeln
Beim Grundangeln liegt der Köder auf oder knapp über dem Gewässergrund. Durch Bleigewichte wird die Montage fixiert, und Bisse werden meist über die Rutenspitze oder ein elektronisches Bissanzeigesystem wahrgenommen.
Vorteile beim Grundangeln:
- ✔️ Sehr effektiv in tieferen Bereichen, Flüssen oder bei Grundnahen Fischarten.
- ✔️ Windunabhängig – kein Einfluss durch Oberflächenbewegung.
- ✔️ Große Auswahl an Montagen möglich – von einfach bis schwer (z. B. mit Futterkorb, Selbsthakmontage, U-Pose auf Wels usw.).
- ✔️ Besonders beliebt beim Angeln auf Aal, Karpfen, Brachsen oder Wels.
Nachteile beim Grundangeln:
- ⚠️ Kein sichtbarer Biss – erfordert Aufmerksamkeit an der Rutenspitze oder Technik.
- ⚠️ Höheres Risiko von Hängern bei Hindernissen am Gewässergrund.
- ⚠️ Weniger spannend für Einsteiger, da der Biss „versteckt“ bleibt.
Wann welche Methode?
Pose ist optimal bei ruhigem Wasser, flachen Zonen oder wenn du mit feinen Ködern wie Maden, Mais oder Teig auf Weißfische oder Forellen gehst. Besonders im Sommer oder an Uferkanten kannst du Posenangeln sehr gezielt einsetzen.
Grundmontagen zeigen ihre Stärke, wenn du auf Grundfische wie Aal, Karpfen oder Wels angelst – vor allem bei Nacht, im tiefen See oder Fluss. Auch bei trübem Wasser oder viel Strömung ist Grundangeln klar im Vorteil.
Zusammengefasst:
Posenangeln ist visuell, feinfühlig und perfekt für Einsteiger in ruhigen Gewässern. Grundmontagen hingegen bieten maximale Ruhe, Stabilität und Vielseitigkeit – vor allem bei schwereren Zielfischen oder schwierigen Bedingungen. Wer beide Methoden beherrscht, ist für fast jede Situation am Wasser gewappnet.
Catch & Release - sinnvoll oder verboten?
Das Zurücksetzen gefangener Fische – bekannt als „Catch & Release“ – ist weltweit verbreitet, aber in Deutschland rechtlich und ethisch umstritten. Während es in vielen Ländern zur bewussten Bestandsregulierung gehört, bewegt man sich hierzulande schnell in einer rechtlichen Grauzone oder macht sich in den meisten Fällen sogar strafbar. Wann ist Catch & Release erlaubt, wann sinnvoll – und wann sogar verboten?
Was bedeutet Catch & Release?
Catch & Release bezeichnet das gezielte Zurücksetzen eines gefangenen Fisches – etwa weil er untermaßig ist, in der Schonzeit gefangen wurde oder nicht verwertet werden soll. Ziel ist es, den Fisch am Leben zu lassen und Bestände zu erhalten.
Gesetzeslage in Deutschland
Nach dem deutschen Tierschutzgesetz darf kein Tier ohne „vernünftigen Grund“ verletzt oder getötet werden. Umgekehrt darf auch kein Fisch verletzt und dann ohne Grund zurückgesetzt werden. Die Entnahme ist in Deutschland gesetzlich nur dann erlaubt, wenn eine Verwertung beabsichtigt ist.
Catch & Release ist verboten, wenn:
- ⚠️ Der Fisch nur aus sportlichem Ehrgeiz oder für ein Foto gefangen und zurückgesetzt wird.
- ⚠️ Maßige Fische ohne Verwertungsabsicht wieder ins Wasser gesetzt werden.
- ⚠️ Kranke oder verletzte Fische zurückgesetzt werden – sie müssen tierschutzgerecht getötet werden.
Catch & Release ist erlaubt oder vorgeschrieben, wenn:
- ✔️ Der Fisch untermaßig ist.
- ✔️ Er während der Schonzeit gefangen wurde.
- ✔️ Die Gewässerordnung ein Zurücksetzen explizit vorschreibt (z. B. bei geschützten oder nicht zu verwertbaren Arten gehört).
Catch & Release im internationalen Vergleich
In vielen Ländern – etwa den Niederlanden, Skandinavien oder den USA – gehört Catch & Release zur gängigen Angelpraxis. Dort entnehmen Angler gezielt nur so viele Fische, wie sie verwerten möchten, und setzen den Rest zurück. Das gilt dort als Beitrag zum Artenschutz und zur Bestandserhaltung.
Auch in Deutschland ist die Entnahme gesetzlich begrenzt. Tagesfangbeschränkungen, Entnahmelisten und Schonzeiten sorgen dafür, dass nicht jeder gefangene Fisch mitgenommen werden darf – selbst wenn er maßig ist. Catch & Release ist in diesen Fällen nicht nur erlaubt, sondern notwendig, um gesetzeskonform zu handeln.
Ethik & Sinn – wann ist Catch & Release sinnvoll?
Richtig durchgeführt kann Catch & Release ein effektives Mittel zur Bestandsschonung sein. Besonders in überfischten Gewässern oder bei kapitalen Laichfischen kann das Zurücksetzen zur Erhaltung gesunder Fischpopulationen beitragen.
Sinnvoll ist Catch & Release besonders:
- ✔️ Bei großen, gesunden Laichfischen mit wertvollem Genmaterial.
- ✔️ In stark befischten Gewässern mit hohem Entnahmedruck.
- ✔️ Bei geschonten oder rückläufigen Arten.
- ✔️ Zur Datenerhebung – z. B. Wiederfangprojekte oder Markierungen.
- ✔️ Zur Erkennung von Krankheiten, Schädlingsdruck oder Veränderungen im Bestand (z. B. Parasiten, Gewichtsverlust).
Weniger sinnvoll oder problematisch ist es:
- ⚠️ Bei sommerlicher Hitze – Stress und Sauerstoffmangel erhöhen die Sterblichkeit.
- ⚠️ Bei falscher Handhabung – zu langes Drillen, trockenes Ablegen oder Luftkontakt.
- ⚠️ Wenn es ausschließlich für Fotos, Likes oder Rekorde betrieben wird.
Catch & Release bei invasiven Arten
Invasive Arten – also solche, die sich unkontrolliert ausbreiten und heimische Arten gefährden – dürfen in vielen Bundesländern nicht zurückgesetzt werden. Ihr unkritisches Zurücksetzen kann erheblichen Schaden im Ökosystem anrichten.
Beispiele für invasive Problemfische:
- ⚠️ Wels (Silurus glanis): Große Exemplare verschlingen Karpfen, verdrängen andere Räuber, fressen Wasservögel und sogar kleine Hunde.
- ⚠️ Schwarzmeergrundel: Frisst Laich, verdrängt Kleinfische und verändert die Nahrungskette.
- ⚠️ Sonnenbarsch: Vermehrt sich explosionsartig, plündert Brutplätze, stört das ökologische Gleichgewicht.
In diesen Fällen gilt: Nicht zurücksetzen, sondern gesetzeskonform entnehmen oder nach Anweisung des Fischereirechts handeln. Jeder Angler trägt Verantwortung für das ökologische Gleichgewicht.
So setzt du Fische richtig zurück
Wenn Catch & Release gesetzlich zulässig oder vorgeschrieben ist, kommt es auf die richtige Durchführung an:
- ✔️ Immer mit nassen Händen oder Kescher anfassen/landen – nie auf den trockenen Boden legen.
- ✔️ Schonhaken verwenden – oder die Widerhaken vorher abpfeilen.
- ✔️ Möglichst unter Wasser abhaken, Zeit in der Luft minimieren.
- ✔️ Keine Fotosessions mit minutenlangem Halten – Sekunden zählen.
- ✔️ Bei angeschlagenem Fisch: Rücksprache mit Gewässerwart oder tierschutzgerechtes Töten.
Zusammengefasst:
Catch & Release ist in Deutschland nur in genau definierten Fällen erlaubt – etwa bei untermaßigen Fischen oder wenn die Gewässerordnung es vorschreibt. Es kann ein wirksames Mittel zur Bestandsschonung und Kontrolle sein – aber nur, wenn es korrekt angewendet wird. Invasive Arten wie Wels oder Grundeln dürfen nicht zurückgesetzt werden. Wer bewusst handelt, schützt Fische, Ökosysteme und die eigene Angellizenz.
Wann beißen Fische am besten?
Ob du heute fängst oder leer nach Hause gehst, hängt oft nicht an der Ausrüstung – sondern am richtigen Zeitpunkt. Tageszeit, Wetter, Jahreszeit und sogar der Mond beeinflussen das Beißverhalten der Fische stärker, als viele glauben. Wer diese Faktoren kennt und richtig deutet, fischt erfolgreicher – ganz gleich ob mit Posenmontage, Kunstköder oder Naturködern.
Tageszeit – morgens oder abends?
Die besten Fangzeiten liegen meist in den Phasen um Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das Licht ist gedämpft, viele Fischarten sind aktiver – vor allem Raubfische wie Barsch, Zander oder Hecht.
- ✔️ Früh morgens: Ideal für Raubfisch mit Gummifisch oder Wobbler (Hard/Softbait).
- ✔️ Abends: Besonders aktiv sind Weißfische wie Rotauge oder Brassen – perfekt für Posenangler.
- ⚠️ Mittags: Viele Arten ruhen, vor allem im Hochsommer.
Jahreszeit – Was läuft wann?
Fische passen ihr Verhalten den Jahreszeiten an. Temperatur, Laichzeit und Nahrungsangebot bestimmen, wie aggressiv oder vorsichtig sie fressen.
- ✔️ Frühling: Guter Zeitpunkt für Zander, Karpfen und Aal – aber achte auf Schonzeiten.
- ✔️ Sommer: Früh und spät am besten – tagsüber eher zäh, aber Grundangeln auf Aal oder Wels funktioniert gut.
- ✔️ Herbst: Die „Fresszeit“ – Top-Saison für Spinnfischer mit großen Ködern & Rollen.
- ✔️ Winter: Langsames Angeln mit kleiner Präsentation – meist Grundmontagen auf passive Fische.
Wetter – Druck, Wind & Licht
Fische reagieren empfindlich auf Wetterumschwünge. Besonders Luftdruck und Lichtverhältnisse beeinflussen ihr Verhalten.
- ✔️ Leichter Regen & bedeckter Himmel: Hohe Aktivität – ideal für Hard- und Softbaits.
- ✔️ Stabiler Luftdruck: Konstantes Wetter bringt konstante Bisse.
- ⚠️ Starker Druckabfall: Fische werden vorsichtig, besonders Hecht, Zander & Barsch.
- ⚠️ Grelles Sonnenlicht: Oft nur frühe oder späte Bissfenster – unsichtbare Vorfächer helfen.
Mondphasen – Mythos oder Wahrheit?
Viele Angler schwören auf die Mondphasen – mit teils überraschenden Beobachtungen:
- ✔️ Vollmond: Gute Nachtbisse bei Raubfisch (z. B. Hecht, Wels).
- ✔️ Neumond: Friedfische wie Brassen oder Schleien beißen vorsichtiger.
- ⚠️ Starke Mondwechsel: Können bei sensiblen Arten zu Bissflauten führen.
Weitere Einflussfaktoren
- ✔️ Wassertemperatur: Ideale Aktivität liegt meist zwischen 12–15 °C – je nach Art.
- ✔️ Wasserstand & Strömung: Hochwasser trübt Sicht – helle Köder & Duftstoffe wirken besser.
- ✔️ Beißzeiten-Apps: Viele Angler nutzen sie als Orientierung, ersetzen aber keine Gewässerkenntnis.
Zusammengefasst:
Die beste Beißzeit ist kein Zufall – sie ergibt sich aus Tageszeit, Wetter, Jahreszeit und Wasserbedingungen. Wer diese Zusammenhänge versteht, fischt gezielter und erfolgreicher. Ein klarer Vorteil für alle, die mehr wollen als nur Glück am Wasser.
Was ist Fliegenfischen?
Fliegenfischen – das ist mehr als nur eine Angeltechnik. Für viele ist es die eleganteste Form des Angelns: leicht, präzise, fast schon tänzerisch. Statt schwere Köder zu werfen, wird beim Fliegenfischen eine künstliche „Fliege“ präsentiert – meist federleicht, handgebunden und kaum schwerer als ein Insekt. Das Ziel: Fische zu überlisten, indem man möglichst nah an deren natürliche Beute herankommt.
Was macht Fliegenfischen besonders?
Im Gegensatz zu klassischen Methoden wird beim Fliegenfischen nicht der Köder, sondern die Schnur geworfen. Die spezielle Fliegenschnur ist dick und schwer – sie bringt die Fliege überhaupt erst auf Weite. Dadurch entsteht der charakteristische „Wurfloop“, den viele aus Filmen kennen.
Typische Ausrüstung beim Fliegenfischen
- ✔️ Fliegenrute: Meist leicht und flexibel, in Längen von 7 bis 10 Fuß.
- ✔️ Fliegenrolle: Dient weniger zum Werfen – mehr als Schnurspeicher & Bremse.
- ✔️ Fliegenschnur: Gewicht vorne, damit sich die Schnur werfen lässt (z. B. WF – weight forward).
- ✔️ Vorfach & Tippet: Verjüngtes Verbindungsstück zwischen Schnur und Fliege.
- ✔️ Fliegenbox: Enthält Trockenfliegen, Nymphen, Streamer – je nach Zielfisch & Gewässer.
- ✔️ Wathose: Gehört fast immer dazu – viele Spots erreichst du nur watend.
Fliegentypen & Köderwahl
- ✔️ Trockenfliegen: Schwimmen auf der Wasseroberfläche – imitieren Insekten.
- ✔️ Nymphen: Sinken ab – imitieren Larvenstadien von Insekten.
- ✔️ Streamer: Größere Imitationen von Kleinfischen – auch für Forelle, Hecht & Barsch geeignet.
Wo funktioniert Fliegenfischen?
Häufige Einsatzgebiete sind Flüsse, Bäche oder Seen mit klarem Wasser – besonders auf Salmoniden (Forelle, Äsche, Saibling). Aber auch in Teichen, auf Karpfen oder sogar im Salzwasser (Sea Trout, Bonefish) kann Fliegenfischen extrem effektiv sein.
Typische Zielfische
- ✔️ Bachforelle, Regenbogenforelle, Äsche
- ✔️ Saibling, Döbel, Barbe
- ✔️ Hecht, Barsch (mit Streamern)
- ✔️ Karpfen (sichtbares Anpirschen mit Brotfliegen möglich)
Vorteile des Fliegenfischens
- ✔️ Unglaublich präzises Angeln auf Sicht möglich.
- ✔️ Extrem schonende Präsentation – kein lautes Platschen.
- ✔️ Vielfältige Imitationen – für nahezu jede Situation anpassbar.
- ✔️ Intensive Naturerfahrung – aktives Angeln, ständiges Bewegen & Beobachten.
Nachteile oder Herausforderungen
- ⚠️ Steile Lernkurve – Wurftechnik ist anspruchsvoller als bei Spinn- oder Grundangeln.
- ⚠️ Wind, Sträucher und Bäume erschweren Würfe erheblich.
- ⚠️ Ausrüstung teurer – besonders bei hochwertigen Fliegenruten & Rollen.
- ⚠️ Weniger effektiv bei stark getrübtem Wasser oder tieferen Seen ohne Sichtkontakt.
Zusammengefasst:
Fliegenfischen ist technisch anspruchsvoll, aber ungemein lohnend. Wer Spaß am Beobachten, an feiner Präsentation und am Erlernen einer ganz eigenen Angeltechnik hat, wird in dieser Disziplin eine neue Dimension des Fischens entdecken. Nicht nur für Forellenjäger – sondern für alle, die mehr wollen als nur Auswerfen & Einholen.
Welcher Köder für welche Fischart?
Die Wahl des richtigen Köders entscheidet über Erfolg oder Schneidertag. Anfänger stehen oft vor der Frage: Welcher Köder passt zu welchem Fisch? Die Antwort hängt von Zielfisch, Gewässer, Jahreszeit und Technik ab. Hier bekommst du einen klaren Überblick – ohne Rätselraten.
Kunstköder oder Naturköder?
Naturköder: Würmer, Maden, Mais, Boilies, Fischfetzen oder Köderfische – besonders effektiv bei vorsichtigen oder standorttreuen Fischen.
Kunstköder: Gummifische, Wobbler, Spinner, Blinker – ideal für aktive Raubfische und flexible Präsentation beim Spinnfischen.
Köderempfehlungen nach Fischart
- ✔️ Barsch: Gummifisch (3–7 cm), Wurm, Dropshot, Jigspinner
- ✔️ Zander: Gummifisch (10–15 cm), Fischfetzen, toter Köderfisch, Wobbler
- ✔️ Hecht: Gummifisch (10-15 cm), Jerkbait, Wobbler, toter Köderfisch
- ✔️ Forelle/Döbel: Teig, Wurm, Spinner, Spoon, kleine Wobbler
- ✔️ Karpfen/Barbe: Boilies, Mais, Tigernüsse, Brotflocken, Tauwurm
- ✔️ Aal: Tauwurm, Fischfetzen, Leber, Mistwurm
- ✔️ Wels: Toter Köderfisch, Blutegel, Tauwurmbündel, U-Posenmontage
- ✔️ Rotauge/Brassen: Maden, Mais, Wurm, Brot
Die Köderwahl sollte natürlich nach größe des Zielfisches angepasst werden, sowie die Gewässerbedingungen und Wetterverhältnisse.
Wann funktioniert was?
- ✔️ Frühjahr: Naturköder oft überlegen – Wasser ist kalt, Fische fressen vorsichtiger.
- ✔️ Sommer: Kunstköder auf Raubfisch – hohe Aktivität bei Hecht, Barsch, Zander.
- ✔️ Herbst: Großköder lohnen sich – Fische fressen sich Reserven an.
- ✔️ Winter: Kleine, langsame Köder – z. B. Nymphen, kleine Kunstköder. Würmer/Maden gehen immer.
Fehler vermeiden
- ⚠️ Nicht jeder Köder passt zu jedem Haken oder Vorfach.
- ⚠️ Zu große Köder = Fehlbisse bei kleinen Zielfischen.
- ⚠️ Falscher Köder in falscher Tiefe/Spot = keine Bisse, egal wie gut er aussieht.
Zusammengefasst:
Die richtige Köderwahl orientiert sich immer am Zielfisch und den Bedingungen. Wer weiß, was Fische wann fressen, fischt nicht nur klüger – sondern auch erfolgreicher, spart Zeit und Geld. Experimentieren ist gut solange man nicht übertreibt aus Fehlern lernt und sich Notizen macht.
Strömung verstehen
Strömung ist mehr als nur bewegtes Wasser – sie entscheidet darüber, wo Fische stehen, wie sie jagen und ob dein Köder überhaupt wahrgenommen wird. Wer sie versteht, fischt gezielter, erfolgreicher und mit weniger Frust. In dieser Section erklären wir, wie du Strömung liest, sie für dich nutzt – und was du je nach Angelmethode beachten solltest.
Warum Strömung wichtig ist
Fische nutzen Strömung, um Energie zu sparen und sich Nahrung zuführen zu lassen. Gerade Raubfische positionieren sich oft an ganz bestimmten Punkten – hinter Hindernissen, an Kehrströmungen oder Übergängen zwischen schnell und langsam fließendem Wasser. Wer das versteht, weiß: Nicht das tiefste Wasser ist der Hotspot – sondern die Zone mit dem besten Futtereintrag.
Strömungsarten & typische Angelplätze
- Hauptströmung: Meist die schnellste Linie im Gewässer. Oft zu stark zum Angeln – aber direkt daneben lauern Fische.
- Kehrwasser & Rückläufe: Ideal für Raubfische. Hier rotiert das Wasser langsam zurück, Nahrung bleibt hängen – und Fische warten im Schatten.
- Prallhang vs. Gleithang: An Flussbiegungen entsteht auf der Außenseite (Prallhang) oft tieferes Wasser mit starker Strömung, innen (Gleithang) ist es flacher und ruhiger. Beide Seiten können Hotspots sein – je nach Fischart.
- Buhnenfelder & Strömungsschatten: Besonders in großen Flüssen entstehen hier „Ruhezonen“, die von Weißfischen wie Raubfischen geschätzt werden.
Tipps für verschiedene Angelmethoden
- Grundangeln: Schwere Bleie oder Strömungsbleie nutzen. Fische meist stromabwärts der Hindernisse.
- Spinnfischen: Köder gegen die Strömung führen – wirkt natürlicher. Auf Strömungskanten und Verwirbelungen zielen.
- Posenangeln: Pose kontrolliert „ablaufen“ lassen, durch leichtes Anbremsen in Hotspots halten.
Extra-Tipp: Strömung bei Hoch- oder Niedrigwasser
Hochwasser: Strömung wird stärker, Fische ziehen sich in geschützte Uferbereiche oder überschwemmte Flachzonen zurück.
Niedrigwasser: Weniger Strömung – Fische konzentrieren sich auf tiefe Gumpen, Einläufe oder sauerstoffreichere Abschnitte.
Verknüpfte Themen:
Wassertemperatur & Aktivität
Fische sind wechselwarme Tiere – ihre Aktivität hängt direkt von der Wassertemperatur ab. Wer das ignoriert, angelt oft zur falschen Zeit am richtigen Spot. In dieser Section erklären wir, wie du die Temperatur als Fang-Booster nutzt – und welche Arten wann besonders aktiv sind. Denn nicht nur das Verhalten, sondern auch das gesamte Ökosystem verändert sich mit jedem Grad mehr oder weniger.
Wie Temperatur das Verhalten beeinflusst
Bei steigender Temperatur steigt auch der Stoffwechsel der Fische – sie werden aktiver, fressen häufiger und wechseln ihre Aufenthaltsorte. Doch jede Fischart hat ihr eigenes Wohlfühlfenster und reagiert unterschiedlich auf Kälte oder Hitze. Wer weiß, wann welcher Fisch in Bewegung kommt, kann gezielter angeln – statt ins kalte Wasser zu werfen.
Wichtig: Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Wassertemperatur, nicht auf die Luft. In Deutschland erreichen flache Seen, Weiher und Teiche im Hochsommer durchaus Werte von über 24 °C – besonders bei direkter Sonneneinstrahlung und wenig Wind. In Fließgewässern und tiefen Seen bleiben die Temperaturen meist deutlich darunter.
- Frühjahr (6–12 °C): Weißfische wie Rotaugen und Schleien kommen in Fahrt. Raubfische wie Hecht und Barsch bleiben noch eher träge.
- Frühsommer (13–18 °C): Zander, Barsche und Forellen zeigen Jagdverhalten. Auch Karpfen beginnen aktiv zu fressen und zu wandern.
- Sommer (19–24 °C): Jetzt geht fast alles – Schleie, Brassen, Karpfen. Auch Zander und Barsch liefern starke Phasen. Doch bei über 24 °C droht Sauerstoffmangel!
- Hochsommer (25+ °C): Viele Arten meiden die Mittagshitze. Aktivitätsphasen verlagern sich in die Dämmerung, Nacht oder in tiefere, kühlere Wasserschichten.
Algenwachstum & Sauerstoffhaushalt
Mit steigender Temperatur blühen Algen auf – sie lieben Wärme, Licht und Nährstoffe. Besonders im Frühling und Sommer vermehren sie sich rasant. Tagsüber produzieren sie Sauerstoff durch Fotosynthese, doch nachts und bei Massenwachstum kehrt sich der Effekt um: Sie verbrauchen Sauerstoff – vor allem in den frühen Morgenstunden kann der Gehalt auf kritische Werte sinken.
Warmes Wasser kann generell weniger Sauerstoff binden als kaltes. Kommt dann noch viel organisches Material wie Faulschlamm, Fischkot oder abgestorbene Pflanzenreste hinzu, droht ein Umkippen des Gewässers. Besonders Flachgewässer oder stark verkrautete Teiche sind gefährdet.
Ab etwa 6–8 Metern Tiefe kann sich bei stehenden Gewässern im Sommer eine Thermokline bilden – eine Sprungschicht, unter der das Wasser plötzlich deutlich kälter und sauerstoffärmer ist. Fische meiden solche Bereiche oder stehen genau darüber.
Friedfische wie Brassen oder Karpfen zeigen bei extremem Sauerstoffmangel deutliches „Kiemenpumpen“ und steigen manchmal sogar an die Oberfläche. In solchen Phasen lohnt sich Angeln oft nur frühmorgens oder nachts.
Verknüpfte Themen:
Luftdruck & Mondphase
„Heute beißt nix, der Mond ist schuld.“ – „Der Luftdruck ist gefallen, jetzt geht’s ab!“ Kaum ein Anglerthema wird so oft diskutiert – und selten wirklich verstanden. In dieser Section klären wir, was dran ist an den ewigen Diskussionen über Druck und Mondphasen – und wann es wirklich einen Unterschied macht.
Luftdruck – unterschätzt oder überbewertet?
Der Luftdruck beeinflusst tatsächlich das Verhalten von Fischen – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Vor allem bei schnellen Veränderungen reagieren sie empfindlich. Sinkt der Druck plötzlich, wirkt sich das auf den Auftriebssinn und den inneren Druck der Schwimmblase aus – besonders bei empfindlichen Arten wie Zander, Barsch und Forelle.
Bei stabil hohem oder stabil niedrigem Druck stellen sich Fische meist schnell um. Doch kurz nach einem Wetterumschwung – z. B. vor einem Gewitter oder beim Durchzug einer Front – kann das Beißverhalten spürbar einbrechen oder plötzlich explodieren. Wichtig: Der Luftdruck wirkt in erster Linie über das gesamte Ökosystem – z. B. durch Lichtveränderung, Insektenflug oder Planktonbewegung.
Fazit: Nicht der absolute Druck zählt, sondern die Veränderungsgeschwindigkeit. Ein fallender Druck kann die Beißlust dämpfen – aber auch den Fressreflex vor einem Wettersturz auslösen.
Mondphase – nur Esoterik oder echter Effekt?
Der Mond beeinflusst die Gezeiten – aber auch das Verhalten von Tieren, inklusive Fischen. Viele Angler berichten von besseren Fängen bei Vollmond oder Neumond. Studien zeigen: Es gibt Hinweise, dass Raubfische in Mondphasen aktiver sind, besonders nachts bei klarem Himmel und starker Lichtreflexion auf dem Wasser.
Doch Vorsicht: In stark befischten Gewässern oder bei hoher Sichtbarkeit sind Fische auch vorsichtiger – der Vollmond kann also Segen oder Fluch sein. Zudem hängen viele Faktoren zusammen: Lichtintensität, Temperatur, Luftdruck und Aktivitätsrhythmus.
Fazit: Der Mond kann das Verhalten beeinflussen – aber nicht allein. Wer beißen will, braucht vor allem eins: zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Was zählt wirklich?
- Luftdruck: Reagieren empfindliche Arten stark drauf – vor allem bei Wetterumschwüngen.
- Mondphase: Kann Einfluss haben – besonders bei Raubfischen und nächtlichem Angeln.
- Aber: Temperatur, Tageszeit, Jahreszeit, Gewässertyp & Angeldruck haben meist deutlich stärkeren Einfluss.
Verknüpfte Themen:
Fischverhalten im Winter
Der Winter ist keine Top-Zeit zum Angeln – das muss man klar sagen. Die Beißphasen sind kurz, die Fische passiv, und viele Gewässer wirken wie ausgestorben. Warum das so ist? Weil Fische wechselwarme Tiere sind – ihr Stoffwechsel passt sich der Umgebungstemperatur an. Je kälter das Wasser, desto langsamer läuft alles: Bewegung, Verdauung, Energieverbrauch. Das macht sie träge – und das Fressen reduziert sich aufs Minimum.
Was im Fischkörper passiert
Sinkt die Wassertemperatur unter ca. 7 °C, stellen viele Fischarten ihre Aktivität fast komplett ein. Der Stoffwechsel fährt runter, die Verdauung wird deutlich langsamer – Fische fressen seltener und deutlich selektiver. Sie schwimmen weniger umher, sondern verharren oft über Stunden oder Tage an ruhigen Rückzugsorten.
Genau das kann dein Vorteil sein: Wer diese Standorte kennt – tiefe Löcher, windgeschützte Buchten, Bereiche mit minimal wärmerem Zufluss – kann gezielt Köder platzieren. Schon Temperaturunterschiede von 1–2 °C können ausreichen, damit sich Fische dort versammeln. Besonders Friedfische reagieren sensibel auf Mikroklima und Struktur.
Was geht noch – und wie?
- Wenig Bewegung, wenig Reiz: Übertriebene Köderführung oder laute Köder schrecken eher ab. Besser: ruhig, klein, punktgenau präsentieren.
- Hecht bleibt aktiv: Als Kaltwasserjäger bleibt der Hecht im Winter einer der wenigen aktiven Räuber – aber auch er wird deutlich langsamer.
- Brachsen & Schleien? Kaum. Viele Friedfische fallen in eine Art Winterstarre – Schleien etwa fressen monatelang gar nicht.
- Mittagszeit nutzen: Kurze Phasen mit Sonne oder leichtem Anstieg der Wassertemperatur bringen oft den einzigen Biss des Tages.
Futter im Winter – weniger ist mehr
- Wenig füttern: Fische fressen weniger – große Futtermengen sättigen schnell und machen träge.
- Leichte Zutaten: Nutze leicht verdauliche Kohlenhydrate wie Paniermehl, Haferflocken oder Semmelmehl.
- Proteine: Fischmehl oder tierische Zusätze können reizen, sollten aber nur in kleinen Dosen ins Futter.
- Dezente Aromen: Knoblauch, Anis oder Krill wirken anziehend – aber bitte nur dezent einsetzen, um nicht zu überladen.
- Präzise füttern: Punktgenaues Anfüttern auf kleine Spots bringt mehr als großflächiges Streuen.
Verknüpfte Themen:
Laichzeit & Schonzeit
Wenn die Tage länger werden und das Wasser wärmer, beginnt für viele Fischarten die wichtigste Phase des Jahres: die Laichzeit. Jetzt geht es nicht ums Fressen oder Kämpfen – sondern ums Überleben der Art. Genau deshalb ist dieser Zeitraum in vielen Regionen gesetzlich geschützt – mit Schonzeiten, Entnahmeverboten oder ausgewiesenen Ruhezonen.
Warum Schonzeiten Sinn machen
Während der Laichzeit sind viele Fische besonders verletzlich: Sie konzentrieren sich auf Revierverteidigung, Nestbau und Fortpflanzung – nicht auf Nahrung. Gesetzlich festgelegte Schonzeiten sollen genau das schützen. Wer in dieser Zeit bestimmte Arten gezielt beangelt oder entnimmt, schadet dem Bestand direkt. In manchen Bundesländern sind bestimmte Gewässer oder Uferbereiche zusätzlich als Laichzonen gesperrt – achte auf regionale Regeln.
Der Drill zur falschen Zeit
Gerade bei Zander, Hecht oder Barsch ist der Drill während der Laichzeit kritisch. Männliche Zander etwa verteidigen ihre Nester oft wochenlang und fressen dabei kaum. Sie sind geschwächt, zeigen Kampfverletzungen und beißen oft nur aus Reflex, nicht aus Hunger. Ein harter Drill oder falscher Umgang kann sie zusätzlich auslaugen – mit tödlichen Folgen für sie und ihren Laich.
Deshalb gilt: Nur weil man sie fangen kann, heißt das nicht, dass man es tun sollte. Wer Verantwortung übernimmt, meidet gezielt Hotspots während der Laichzeit – oder wählt Köder und Methoden, die andere Arten ansprechen.
Was du als Angler tun kannst
- Schonzeiten respektieren: Informiere dich über die Regeln in deinem Bundesland und an deinem Gewässer.
- Laichplätze meiden: Flache, strukturreiche Bereiche sind typische Laichzonen – halte Abstand, besonders bei klarem Wasser.
- Gezielter angeln: Verwende Köder, die andere Arten bevorzugen, oder fische tiefer, wenn z. B. Zander an Uferkanten laichen.
- Fisch zurücksetzen? Nur wenn er fit ist: Geschwächte Laichfische sollten so kurz wie möglich an der Luft sein – oder gar nicht erst gefangen werden.
Angeln in der Laichzeit ist keine Frage von Legalität allein – sondern von Haltung. Wer heute schützt, was morgen noch beißen soll, denkt wie ein echter Angler.
Verknüpfte Themen:
Invasive Fischarten in deutschen Gewässern
Invasive Arten sind nicht-heimische Tiere, die sich in unseren Gewässern ausbreiten und das ökologische Gleichgewicht stören. Sie verdrängen heimische Arten, verbreiten Krankheiten oder zerstören Lebensräume. Hier stellen wir einige der größten Problemarten vor.
- Schwarzmund-Grundel: Eingewandert über den Schiffsverkehr aus dem Schwarzmeerraum. Frisst Fischlaich, wirbellose Tiere und verdrängt heimische Kleinfische durch aggressives Revierverhalten.
- Sonnenbarsch: Ursprünglich aus Nordamerika. Breitet sich besonders in warmen, flachen Gewässern aus. Konkurriert mit heimischen Arten um Nahrung und Raum – gefährlich für Elritze & Co.
- Wels (Silurus glanis): In manchen Regionen nicht heimisch und künstlich eingebracht. Seine Rolle als Spitzenprädator verändert die gesamte Nahrungskette – speziell in kleinen oder sensiblen Gewässern.
- Amerikanischer Signalkrebs: Träger der Krebspest, gegen die europäische Flusskrebse keine Abwehr haben. Verdrängt heimische Arten, zerstört Pflanzenbestände und gräbt Uferbereiche unter – massiver Eingriff ins Ökosystem.
Diese Arten dürfen in vielen Bundesländern nicht zurückgesetzt werden. Ihre Bekämpfung ist aktiver Artenschutz!
Das sagt das Bundesministerium zum Thema: Invasive gebietsfremde ArtenDarf man mit Zelt angeln?
Das Angeln mit Zelt ist unter Anglern weit verbreitet, besonders bei langen Ansitzen auf Karpfen oder Wels. Doch so entspannt das Schlafen am Wasser auch klingt, so komplex kann die Rechtslage sein. Hier erfährst du, was erlaubt ist, worauf du achten musst und warum selbst Vereinsmitglieder nicht automatisch grünes Licht haben.
Was sagt das Gesetz?
In Deutschland gibt es kein einheitliches Gesetz, das das Zelten beim Angeln regelt, stattdessen ist das Naturschutzrecht der Bundesländer ausschlaggebend. Entscheidend ist, ob das Zelt als "wildes Campen" eingestuft wird, was in vielen Regionen verboten ist.
- Biwaks ohne Boden (Angelschirme, Bivvys): In den meisten Bundesländern geduldet, sofern keine dauerhafte Nutzung erfolgt.
- Zelte mit Boden: Gelten meist als "Campen" – hier drohen Bußgelder oder Anzeigen wegen Verstoß gegen das Naturschutzgesetz.
- Naturschutzgebiete & Uferzonen: Häufig streng geregelt – dort ist das Aufstellen von Zelten generell untersagt.
Regelungen in Angelvereinen
Auch Angelvereine haben häufig eigene Vorschriften, die das Zelten einschränken oder komplett untersagen, selbst wenn es gesetzlich erlaubt wäre.
- Nur Vereinsmitglieder mit Erlaubnis: In manchen Vereinen darf nur nach schriftlicher Genehmigung mit Zelt geangelt werden.
- Maximale Aufenthaltsdauer: Oft ist das Biwakieren nur für eine Nacht erlaubt.
- Keine offenen Feuerstellen: Gaskocher sind in der Regel gestattet, offenes Feuer hingegen nicht.
Unterschied Biwakieren vs. Zelten
Biwakieren (z. B. unter einem Angelschirm) wird häufig toleriert, da es als kurzfristiger Wetterschutz gilt. Zelten mit Boden hingegen wird als Übernachtung im klassischen Sinne gewertet, mit allen rechtlichen Konsequenzen.
Tipps für rechtssicheres Angeln mit Zelt
- Nutze Bivvys ohne Boden, um als Biwak durchzugehen.
- Frage deinen Verein oder den Gewässerwart vorab nach den Regeln.
- Meide geschützte Uferzonen, halte Abstand zur Vegetation und zerstöre sie nicht willkürlich.
- Hinterlasse keinen Müll und halte dich an bestehende Vorschriften. Nimm den Müll von anderen mit.
Bußgelder & Konsequenzen
Je nach Bundesland und Gebiet können Bußgelder von 50€ bis über 5000€ drohen. Etwa bei Verstößen gegen das Naturschutzrecht oder unerlaubtes Zelten in Schutzgebieten (kann als Wilderei geahndet werden).
Wichtig: Auch eine gültige Angelkarte oder ein Vispas ersetzt keine Genehmigung zum Zelten!
Weitere Infos & Quellen
Müll am Wasser & die Verantwortung der Angler
Leere Maisdosen, Angelschnur, Verpackungen – leider keine Seltenheit an beliebten Angelspots. Dabei ist jeder Angler in der Pflicht, das Gewässer sauber zu hinterlassen. Denn Müll belastet nicht nur die Umwelt, sondern schadet auch dem Ruf unseres Hobbys.
Viele Fischereivereine und Gewässerpächter beobachten zunehmend, dass Angelplätze vermüllt sind. Das führt nicht nur zu schärferen Kontrollen, sondern im Extremfall zu Angelverboten oder dem Verlust von Pachtverträgen. Wer sauber angelt, schützt nicht nur die Natur, sondern auch seine Angelmöglichkeiten.
Doch nicht nur Angler sind gefragt: Auch Spaziergänger, Grillfreunde und Partygäste an Uferzonen tragen eine Verantwortung. Offenes Feuer, achtlos entsorgte Flaschen und Verpackungen verschmutzen das Wasser und gefährden Tiere. Wer die Natur genießt, sollte sie auch bewahren.
- Bußgelder: In manchen Bundesländern bis zu 500€ bei nachgewiesenem Müllverstoß.
- Vereinsstrafen: Verwarnung oder sogar Ausschluss bei wiederholtem Fehlverhalten.
- Wildtiere: Müllreste wie Schnur oder Haken können für Vögel und Fische lebensgefährlich sein.
- Gewässerbild: Saubere Ufer fördern Akzeptanz in der Bevölkerung und verhindern Angelverbote.
- Vorbildfunktion: Wer Müll anderer mitnimmt, setzt ein Zeichen für Respekt und Umweltschutz.
- Prävention: Bereite Köder und Zubehör vorab zu Hause vor, um Verpackungsmüll zu vermeiden.
- Verpackung: Nutze wiederverschließbare Dosen oder Boxen für Proviant, statt Einwegverpackungen.
- Müllmanagement: Immer Mülltüten mitnehmen – auch für unvorhergesehene Abfälle oder Fundstücke.
- Vermeidung: Plane deinen Angelausflug so, dass du keine überflüssigen Materialien mitbringst, z. B. durch minimalistische Köder- und Essensplanung.
- Nachhaltige Ausrüstung: Verwende biologisch abbaubare Produkte und langlebige Tools, um Ressourcen zu schonen.
- Allgemeiner Appell: Jeder, der sich an Gewässern aufhält – ob Angler, Spaziergänger oder Grillfreund – sollte seinen Müll wieder mitnehmen.
- Feiern am Wasser: Alkohol, Grillreste und Musik sind kein Freifahrtschein für Umweltverschmutzung. Bleib respektvoll – Natur ist kein Festivalgelände.
Weitere Infos zum Thema Gewässerpflege findest du hier: Gewässerpflege im Herbst
Auch sehr interessant! Ökosysteme schützen und stärken
Was gehört in die Grundausstattung beim Angeln?
Ob Tagestrip oder Wochenendabenteuer – wer ans Wasser zieht, sollte gut vorbereitet sein. Die richtige Grundausstattung ist nicht nur komfortabel, sondern auch entscheidend für den waidgerechten Umgang mit dem Fisch. Hier findest du die wichtigsten Punkte für verschiedene Angelarten, damit du sicher, effektiv und gesetzeskonform unterwegs bist.
Tages-Ansitzangeln – Basics für entspannte Stunden
- Rute & Rolle: Je nach Zielfisch – z. B. 2,70 m bis 3,30 m mit 30–80 g Wurfgewicht für Karpfen oder Aal.
- Kescher: Immer dabei! Größe & Netzstruktur je nach Fischart und Angelmethode wählen.
- Betäuber & Messer: Für waidgerechtes Töten und Versorgen des Fisches.
- Abhakmatte: Besonders bei größeren Fischen Pflicht – schützt Schleimhaut und Fischkörper.
- Stiefel oder Wathose: Erleichtern das sichere und schonende Landen in Flachwasserzonen.
- Stuhl & Wetterschutz: Angelstuhl für Komfort, Tarp oder Schirm als Regenschutz.
- Kleinteile: Vorfachmaterial, Bissanzeiger, Wirbel, Blei, Haken, Köderbox etc.
Nachtansitz – Vorbereitung ist alles
- Zelt ohne Boden: Nur dann zählt es als Biwakieren und ist meist erlaubt. Achte auf hohe Wassersäule (ab 3000 mm).
- Stirnlampe: Ideal mit Akku, dimmbar und roten Licht
- Powerbank: 25000mAh reicht locker für Lampe & Handy.
- Kocher: Kleine Gaskocher ermöglichen warmes Essen – steigert Komfort enorm.
- Betäuber & Messer: Für waidgerechtes Töten und Versorgen des Fangs.
- Setzkescher: Nur bei erlaubtem Gebrauch – z. B. für Köderfische.
- Feldbett & Packmaß: Kompakt, leicht und platzsparend – beachte Autogröße.
- Müllbeutel: Direkt sichtbar aufhängen – auch für Schnurreste, Verpackungen & Co.
- Schlafsack: Beim kauf darauf achten für welche Temperaturen der Schlafsack ausgelegt ist und aus welchem Material das Futter (die Füllung) besteht. Vor/Nachteile beachten und an Saison anpassen.
- Kühlbox mit Kühlakkus: Für frischen Fischtransport bei längeren Sessions.
Spinnfischen – mobil & effizient
- Zielfischgerechte Rute: Für Barsch z. B. 2,40 m mit 5–20 g Wurfgewicht.
- Kescher & Tools: Gummiertes Netz, Hakenlöser, Maßband, Betäuber, Messer.
- Rucksack: Mit kleinen Boxen für Köder, Snaps, Vorfächer etc.
- Verpflegung: Kompakt und leicht – ideal für flexible Touren.
- Abhakmatte: Auch hier gilt Pflicht – schützt Schleimhaut und Fischkörper.
- Polbrille: Schützt die Augen & ermöglicht Sicht auf Fische unter Wasser.
- Gutes Schuhwerk: Rutschfest & bequem – besonders an steilen, bewachsenen Ufern.
- Wetter-Kombi: Regenjacke im Rucksack, Zweitoutfit im Auto oder Zelt bereit.
Zusätzlicher Tipp: Informiere dich immer vorab über örtliche Regelungen und Besonderheiten des Gewässers. So bist du nicht nur optimal vorbereitet, sondern schützt auch Umwelt und Fisch.
Müll am Wasser – Verantwortung der Angler | Wie war das nochmal mit dem Zelten?
Rutenwahl – Einsteiger-Guide
Die Wahl der richtigen Angelrute ist entscheidend für den Fangerfolg. Je nach Gewässer, Angeltechnik und Zielfisch variieren Länge, Wurfgewicht und Empfindlichkeit der Spitze erheblich. Hier findest du eine Übersicht, um deine Rute optimal abzustimmen.
Spinnfischen – Mobil & gezielt unterwegs
- Große Seen & Weitwurf: Rutenlänge 2,70–3,00m, Wurfgewicht 30–80g. Kräftige Spitzen für schwere Kunstköder.
- Kleine Flüsse & Uferangeln: 2,10–2,40m, Wurfgewicht 10–50g. Sensible Spitze für präzise Würfe & feine Führung.
- Feinere Köder (z. B. Spinner, Jigs): Ruten mit 5–30g Wurfgewicht, sensible Spitzen für Barsch, Forelle & Co.
Bootsangeln & schwere Kaliber
- Allgemeines Bootsangeln: 1,80–2,40m, platzsparend, mittleres Wurfgewicht für Zander, Barsch & Hecht.
- Wels & schwere Köder: Ruten mit bis zu 250g Wurfgewicht z.B. fürs Vertikalangeln in tiefen Seen, extra starkes Rückgrat und kräftige Spitze.
Ansitzangeln – Grund- & Posenmontage
- Grundmontage für Aal & Karpfen: Länge 2,70–3,60m, Wurfgewicht je nach Montage & Gewässer 40–100g. Spitze bei Aal weicher, bei Karpfen steifer.
- Posenangeln: Je nach Zielfisch unterschiedliche Spitzenempfindlichkeit. Leicht biegsame Spitzen, geringes Wurfgewicht für feine Bisserkennung.
- Grundmontage & Feederangeln auf mittelgroße Weißfische: 3,00–4,20m, Wurfgewicht 40–80g. Feine Wechselspitzen ermöglichen sensible Bisserkennung.
- Posenangeln auf Weißfische: 3,00–4,50m Matchrute oder lange Bologneserute, Wurfgewicht 10–30g. Leicht und ausbalanciert für kontrolliertes Treiben.
Stippruten – direkt, effektiv, klassisch
- Länge: 5–9m, für weißfischreiche Uferbereiche. Besonders lang für Reichweite ohne Rolle.
- Teleskop-Ausführung: Einfacher Transport, ideal für Einsteiger. Inkl. Vorfach, direkt einsatzbereit.
- Hinweis: Ab 5m wird es sperrig – beachte Transportmaße!
Rollengrößen nach Einsatzgebiet
- Spinnfischen | Ansitz: Für gewöhnlich 2000–4000 je nach Zielfisch & Rute (leicht bis mittel).
- Ansitz auf Karpfen & Wels: 5000–10000, viel Schnurfassung & Kraftreserven im Drill.
- Hier findest mehr zum Thema Rollengröße
Je niedriger das Wurfgewicht, desto sensibler ist in der Regel die Rutenspitze – besonders bei längeren Ruten. Feeder- und Matchruten arbeiten mit austauschbaren Spitzen, die besonders feine Bisse sichtbar machen. Achte beim Werfen mit leichten Spitzen auf eine saubere Technik, um Brüche zu vermeiden – besonders bei höheren Gewichten im oberen Bereich der angegebenen Wurfklasse.
Alle Informationen sind als einsteigerfreundliche Richtwerte zu verstehen. Jeder Angler entwickelt mit der Zeit eigene Strategien & Angeltechniken, ob beim Ansitz oder Spinnfischen. Jeder Angler hat andere Gewässer vor der Tür, also vorbereitet ans Wasser und erfinde deine Strategie!
Merke: Die Kombination aus Rutenlänge, Wurfgewicht und Rollengröße bestimmt, wie effizient du in deinem Revier agieren kannst. Gute Vorbereitung spart Frust und erhöht die Fangchancen deutlich.
Was gehört in die Grundausstattung beim Angeln? | Teleskop oder Steckrute?
Lost in Nature bietet praktische Tipps für Spinnfischen, Ansitzangeln, Raubfischangeln, Friedfischangeln, Angelmontagen und mehr – ideal für Anfänger, Einsteiger und Hobbyangler in Deutschland und den Niederlanden. Unsere Enzyklopädie erklärt Ausrüstung, Köderwahl, Angeltechniken und Fischverhalten verständlich und aktuell für 2025. Gesetze können von Bundesland zu Bundesland abweichen. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, bitte vor dem angeln ausführlich informieren!
